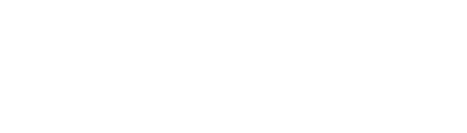Warum braucht BGM klare Messgrößen?
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist längst mehr als ein freiwilliges Zusatzangebot – es ist ein strategischer Baustein moderner Unternehmensführung. Doch trotz wachsender Bedeutung bleibt eine zentrale Frage oft unbeantwortet: Wie macht man BGM messbar.
Ohne belastbare Daten und Kennzahlen bleibt BGM eine subjektive Erfahrung: Maßnahmen werden zwar angeboten, aber ihr tatsächlicher Nutzen bleibt unklar. Führungskräfte tun sich schwer, den Mehrwert zu erkennen – und Mitarbeitende verlieren Vertrauen, wenn Angebote ins Leere laufen.
Messbarkeit ist der Schlüssel, um BGM zielgerichtet, wirksam und zukunftsfähig zu gestalten.
Was bedeutet Erfolg im BGM?
BGM-Erfolg ist nicht pauschal messbar wie der Umsatz oder die Produktivität. Stattdessen geht es um vielfältige Ziele, die sowohl harte als auch weiche Faktoren betreffen:
- Reduktion von Krankheitstagen
- Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
- Höhere Beteiligung an Gesundheitsangeboten
- Verbesserte psychische Gesundheit
- Gesunde Führung und Unternehmenskultur
- Nachhaltige Verhaltensveränderung
Je nach Zielstellung ergeben sich unterschiedliche Key Performance Indicators (KPIs), die dabei helfen, Fortschritte sichtbar zu machen.
Sinnvolle KPIs im BGM
A. Gesundheitsbezogene Kennzahlen
Diese KPIs lassen sich objektiv erfassen und sind meist über HR-Abteilungen verfügbar:
- Krankenstand in %
- Durchschnittliche Fehltage pro Jahr
- Langzeiterkrankungen (Anteil > 6 Wochen)
- Unfallquote im Betrieb
Diese Kennzahlen zeigen objektiv, wie gesund oder belastet die Belegschaft ist – allerdings meist im Rückblick.
B. Teilnahmerdaten
- Anteil der Mitarbeitenden, die Gesundheitsangebote wahrnehmen
- Regelmäßige Teilnahme an spezifischen Maßnahmen (z. B. Rückenkurse, Check-ups)
- Entwicklung der Teilnahmequote im Zeitverlauf
Diese Zahlen sagen etwas über die Akzeptanz der Maßnahmen – und ob das Angebot überhaupt ankommt.
C. Weiche Faktoren aus Befragungen
- Mitarbeiterzufriedenheit mit Gesundheitsangeboten
- Stresslevel, Belastung, Work-Life-Balance
- Wahrgenommene Wertschätzung und Gesundheitskultur
- Veränderungen im Gesundheitsverhalten
Diese Kennzahlen sind subjektiv, aber enorm wichtig für die strategische Steuerung.
D. Organisationskennzahlen
- Anteil der Führungskräfte mit BGM-Schulung
- Budgetentwicklung für BGM
- Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Quartal
- Integration von BGM in Unternehmensziele oder Leitbild
Diese KPIs zeigen, wie stark das Thema Gesundheit in der Organisation strukturell verankert ist.
E. Finanzielle Kennzahlen
- Kosten durch krankheitsbedingte Fehlzeiten
- Fluktuationskosten
- Einsparungen durch Prävention
- ROI von konkreten Maßnahmen (z. B. Gesundheitsprogramme)
Finanzkennzahlen können helfen, BGM auch gegenüber der Geschäftsführung als Investition mit Wirkung zu legitimieren.
Erfolgskriterien: Wann ist BGM „erfolgreich“?
Nicht jede Maßnahme führt sofort zu sinkenden Fehlzeiten oder besserer Stimmung. Daher ist es wichtig, realistische Erfolgskriterien zu definieren:
- Maßnahmen führen zu hoher Beteiligung
- Die Zufriedenheit mit Angeboten steigt
- Führungskräfte leben Gesundheit vor
- Belastungen werden erkannt und reduziert
- Eine Kultur der Prävention entwickelt sich
- BGM wird als Teil der Unternehmensstrategie verstanden
Merke: Erfolg im BGM ist nicht immer kurzfristig sichtbar – er zeigt sich oft mittel- bis langfristig in stabileren Teams, gesünderer Zusammenarbeit und sinkender Belastung.
Die größten Don’ts bei der BGM-Messung
Damit BGM-Messung wirklich Wirkung entfaltet, müssen einige typische Fehlerquellen unbedingt vermieden werden:
❌ 1. Unklare Zielsetzung
Wer nicht weiß, was er messen will, misst im Zweifel irgendetwas – und zieht daraus falsche Schlüsse. Beispiel: Die Teilnahmequote an einem Rückenkurs sagt nichts über dessen Wirkung auf den Krankenstand aus, wenn die Zielgruppe nicht richtig adressiert wurde.
Tipp: Klare Ziele vorab definieren – z. B. „Stressbelastung in Abteilung X senken“ statt „mehr Gesundheit fördern“.
❌ 2. KPIs ohne Zusammenhang zur Maßnahme
Oft werden Zahlen erhoben, die nichts mit der Maßnahme zu tun haben. Wenn z. B. ein Ernährungskurs angeboten wird, aber als KPI nur die Unfallstatistik herangezogen wird, entsteht ein verzerrtes Bild.
Tipp: Jede Maßnahme braucht mindestens einen passenden KPI, der einen direkten Bezug zur Intervention hat.
❌ 3. Vernachlässigung weicher Faktoren
Viele Organisationen messen nur „harte“ Zahlen wie Fehlzeiten oder Kosten – dabei sind es oft die „weichen“ Faktoren wie Wohlbefinden, Wertschätzung und psychische Gesundheit, die über langfristige Effekte entscheiden.
Tipp: Mindestens einmal jährlich Feedback oder Pulsbefragung durchführen.
❌ 4. Messung ohne Kommunikation
Kennzahlen, die nur intern gesammelt und nie rückgespiegelt werden, verlieren an Bedeutung. Mitarbeitende wollen sehen, dass ihre Teilnahme, ihr Feedback und ihre Bedürfnisse etwas bewirken.
Tipp: Ergebnisse transparent machen und kommunizieren – z. B. über Intranet, Teammeetings oder ein BGM-Newsletter.
❌ 5. Keine Differenzierung nach Zielgruppen
Was für die Verwaltung passt, ist für die Produktion vielleicht ungeeignet. Wer alle über einen Kamm schert, riskiert verzerrte Ergebnisse.Tipp: Wenn möglich, KPIs nach Standort, Abteilung oder Altersgruppe auswerten, um gezielter steuern zu können
❌ 6. Keine Weiterentwicklung der KPIs
Wenn seit drei Jahren dieselben Kennzahlen erhoben werden, ohne dass sich daraus neue Maßnahmen oder Impulse ergeben, wird das Messsystem zum Selbstzweck.
Tipp: KPIs regelmäßig hinterfragen, ergänzen oder anpassen. Neue Maßnahmen? Neue KPIs!
❌ 7. Datenschutzverletzungen
Besonders bei sensiblen Daten (z. B. Gesundheitsangaben, psychische Belastung) ist Sorgfalt oberstes Gebot. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, ausspioniert zu werden, leidet das Vertrauen ins gesamte BGM.
Tipp: Alle Erhebungen anonymisiert und DSGVO-konform gestalten – und transparent über Ziele und Auswertung informieren.
5. Fazit: Messbarkeit schafft Wirksamkeit
BGM kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn es regelmäßig überprüft, hinterfragt und auf Wirkung hin gesteuert wird. Dazu braucht es keine überladenen Dashboards oder teuren Tools – sondern eine klare Linie: Was wollen wir verbessern? Wie messen wir das? Und was lernen wir daraus?
Gute KPIs helfen dabei, Ressourcen gezielt einzusetzen, Maßnahmen zu optimieren und Erfolge sichtbar zu machen – für Mitarbeitende, Führungskräfte und die Geschäftsleitung gleichermaßen.
Wichtig ist nicht, alles auf einmal zu messen. Viel wichtiger ist, mit einer soliden Datengrundlage, einem offenen Dialog und klaren Zielen zu starten. Denn eines ist sicher: Nur wer misst, kann besser werden.
Tipp zum Schluss:
Starte mit 3–5 gut gewählten KPIs, die zu deinen Zielen passen – und wachse von dort. Qualität vor Quantität.